Digital/Teilen: Die beste elektronische Musik im Juli, bewertet
Digital/Divide ist eine monatliche Kolumne, die allen Genres und Subgenres in der großen schönen Welt der elektronischen und Tanzmusik gewidmet ist.

Mit einem umfangreichen Katalog voller pseudonymer Werke bleibt Kevin Martin nach Jahrzehnten im Spiel erfolgreich. Nach Jahren der Partnerschaft mit Justin Broadrick von Godflesh wurde er als The Bug zu einer eindrucksvollen Kraft sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Ausland. Wenige können Bass so geschickt einsetzen wie Martin, typischerweise in Form von Dancehall- und Reggae-Formen. Seine Live-Sessions stoßen regelmäßig an die Grenzen selbst der besten Soundsysteme, ganz zu schweigen von menschlichen Trommelfellen.
Ein wesentlicher Bestandteil von Martins Arbeit als The Bug beruht auf Zusammenarbeit. Frühere Platten wie Pressure aus dem Jahr 2003 brachten ihn mit jamaikanischen Talenten wie Daddy Freddy und Wayne Lonesome zusammen, während neuere Kooperationen Dylan Carlson von der Drone-Metal-Band Earth und den Post-Dubstep-Liebling Burial umfassen. Diese Bestrebungen schienen ihn stets auf Augenhöhe mit oder prominenter als die anderen Künstler zu platzieren. Vielleicht erklärt dies, warum das neue Album, das die israelische Sängerin Miss Red ins Rampenlicht rückt, so bedeutsam und anders wirkt.
Früher bekannt für ihre Beiträge zu Gaikas Security-EP und The Bugs Album Angels & Devils, schallt ihre unvorhersehbare Stimme über K.O. [Pressure]. Schwankend zwischen bedrohlich zurückhaltend und aufrecht ausgelassen, zerstört Miss Reds Darbietung jedes Mal. Kühl und unheilvoll herrscht sie über „One Shot Killa“ und „War“, zwei Highlights des Albums. Und ja, bei allem Respekt gegenüber The Bug, dies ist ihre Show. Von der brutalen Eröffnung „Shock Out“ bis zur tanzbaren Dynamik von „Come Again“ und darüber hinaus, Martins Riddims erinnern an Kolbenstärke und Präzision, ein Beweis für sein Können. Doch Miss Red verdient hier ihren Sternenauftritt, beeindruckend auf dem digitalen „Clouds“ und dem dystopischen „Memorial Day“. Dancehall-Fans und -Neulinge sollten ihren Zerstörungswelle mitbekommen.

Lotic, Power [Tri Angle]
Kein Wunder, wenn man ihre Verbindung zur weltweiten Avantgarde Björk bedenkt, dass diese in Houston geborene und in Berlin ansässige Künstlerin Tradition mit dem Unkonventionellen in diesem lang erwarteten Album vereint. Man könnte ihr Interesse an texanischen Marschkapellen übersehen, wenn man den industriellen Rhythmen von „Distribution Of Care“ oder dem Titeltrack zuhört. Sie packen und packen viel aus im gesamten Power, wobei Geschlechts- und Rassenidentität sehr im Vordergrund stehen. Ihr geflüstertes Refrain auf „Hunted“ verursacht Gänsehaut, während sorgfältige Maschinen und Synth-Riffs eine angespannte Atmosphäre schaffen. Was sie mit einer ziemlich einfachen Formel aus Melodie und Lärm erreichen, trotzt dem Genre und übertrifft Erwartungen, zerquetscht Tanzflächen zu Ketamin-Staub bei „Resilience“ und dem Peitsche-aufpeitschenden „Heart“. Für ein thematisch auf Ermächtigung ausgerichtetes Album bieten zärtliche Momente wie „Fragility“ wertvolle und sehr geschätzte Zeit zur Reflexion über die Aussagen und Klänge anderswo auf der Platte. Der Schlusstitel „Solace“ kanalisiert die seltsame Brillanz ihres isländischen Freundes mit einer schrillen Ballade voller hoffnungsvoller Gefühle.

Ratgrave, s/t [Apron]
Während der gewählte Spitzname für dieses Projekt etwas Unanständiges und Unerhörtes suggeriert, hat Ratgrave mehr mit Künstlern wie Thundercat als mit Cattle Decapitation gemeinsam. Ihr gleichnamiger Ausflug rundet eine dreijährige elektronische Jazz-Reise für Max Graef und Julius Conrad ab, in Berlin ansässige Künstler mit Veröffentlichungen auf Labels wie Ninja Tune und Tartelet Records. Egal wie lustig und augenzwinkernd es wird, Ratgrave fühlt sich selten wie eine Scharade an, ein Gespenst, das immer über zeitgenössischen Platten zu schweben scheint, die auf Fusions Funk- und Soul-Immersion zurückgreifen. „Fantastic Neckground“ galoppiert auf seinem Bassline, während „Blizzard People“ mit einem fröhlichen Hammond-Orgel-Part durch die Gegend hüpft, bevor es in Boards Of Canada-Seligkeit ausklingt. Abgesehen von den albernen Namen gibt es etwas Echtes in der Experimentierfreudigkeit von „Big Sausage Pizza“ und „El Schnorro“, ganz zu schweigen von dem „Kitchen Sink“-Opener „Icarus“. Selbst wenn Conrad und Graef wirklich nur herumalbern, machen ihre offensichtlichen Talente dies dennoch zu einer schönen Ergänzung zum neuen Kanon neben Thundercats Drunk.
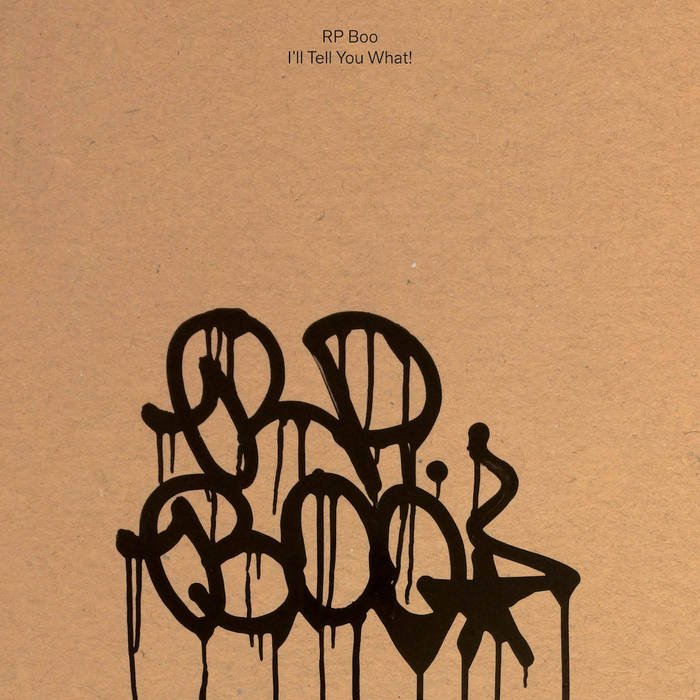
RP Boo, I'll Tell You What! [Planet Mu]
Eine bemerkenswerte Sache an Kavain Spaces Diskografie für das footwork-freundliche Label Planet Mu ist ihre vorwiegend archivistische Natur, bei früheren Alben wie Fingers, Bank Pads, & Shoe Prints aus dem Jahr 2015, die eher wie Kompilationen statt Alben wirken. Daher verdient die Ankunft seines neuesten Sets, dem ausrufsfreudigen I’ll Tell You What!, Aufmerksamkeit wegen seines singulären Fokus auf das Neue. Als einer der Begründer des Genres könnte ihm kaum ein Vorwurf gemacht werden, wenn dieses frischere Material im Vergleich zum Rest des RP Boo-Katalogs geringfügig schien. Glücklicherweise halten diese zwölf Stücke sowohl den Klassikern des Godfathers als auch denen der aktuellen Stars der Szene stand. Die desorientierende Qualität von „At War“ hält ihn mit den experimentelleren Tendenzen von Footwork verbunden, während das Stevie Wonder versehende „U-Don’t No“ die absolute Schönheit in Sample-basierter Musik demonstriert. Ob er nun soulvolle Klänge auf „Earth’s Battle Dance“ verteilt oder Ihre Lautsprecher auf die Bassreaktion bei „Bounty“ testet, RP Boo fesselt durchgehend.

Xzavier Stone, THIRST [Fractal Fantasy]
Einer der besten Trends dieser Phase der 2010er Jahre ist die ständige Erosion der Grenzen zwischen R&B, Hip-Hop und experimenteller Musik, größtenteils, aber nicht ausschließlich, via die amorphe urbane Welt des Bass. In diesem sich noch immer ausdehnenden Feld von Produzenten kann man sich darauf verlassen, dass Sinjin Hawke und Zora Jones einen Gewinner auswählen, und ihre neueste Veröffentlichung von Xzavier Stone auf ihrem Label beweist es. Ein clubtaugliches Set für eine bestimmte Denkweise, wechselt sein Album geschickt und stilvoll zwischen aggressiv („Po It Up“) und futuristisch funky („Roll 2 Tha Door“). Eine Reihe von Kringeln, Schnappschüssen und atemlosen Forderungen, „Give Me Sum“ klingt, als würde Oneohtrix Point Never sein Glück bei trappy EDM versuchen. Der Schwung synthetisierter Streicher auf „Chokehold“ geht nahtlos in das klaviergetriebene „XLYT“ über. Zuweilen in extraterrestrische Töne verarbeitet, spielen Stones Vocals hier eine bedeutende Rolle, indem sie sowohl Botschaft als auch Textur zu „CCW“ und „Oud“ hinzufügen.
Underworld & Iggy Pop, Teatime Dub Encounters [Caroline]
Sture Stooges könnten bei diesem gemeinsamen Werk die Stirn runzeln, wie viele es bei Lou Reed und Metallicas weitaus radikalerem LuLu taten. Diejenigen, die nicht vorschnell darauf reagieren, wenn ihre Lieblingskünstler spät in ihrer Karriere neue Wege beschreiten, werden feststellen, dass Iggy Pop mit den Underworld-Jungs viel mehr Spaß beim Tanzen hat als beim Jammen mit Josh Homme. Der Punk-Godfather hat das Performance-Poetry bereits zuvor gemacht, insbesondere auf seinem Solo-Album Avenue B von 1999. Wenn der motorik-techno Opener „Bells & Circles“ Iggy eine harmlose Hypothese präsentiert, antwortet er mit Erinnerungen an verpasste Verbindungen, liberale Demokratie und alte Zigaretten. Er gibt sein Bestes, um über das Suicide-ähnliche „Trapped“, ein Cyberpunk-Ditty, das von Wiederholung angetrieben wird, eine Alan Vega-Imitation abzugeben. Karl Hyde und Rick Smith geben der tiefen Stimme des Älteren auf „I'll See Big“ viel Raum, seine Überlegungen zu Freundschaft und Beziehungen unterschiedlicher Art kommen wie benebelte Weisheiten rüber. „Get Your Shirt“ kommt dem Underworld-Ästhetik am nächsten, jubilierend und episch durch und durch.
Gary Suarez ist in New York geboren, aufgewachsen und lebt dort immer noch. Er schreibt über Musik und Kultur für verschiedene Publikationen. Seit 1999 erschienen seine Arbeiten in diversen Medien, einschließlich Forbes, High Times, Rolling Stone, Vice und Vulture. Im Jahr 2020 gründete er den unabhängigen Hip-Hop Newsletter und Podcast Cabbages.








